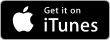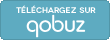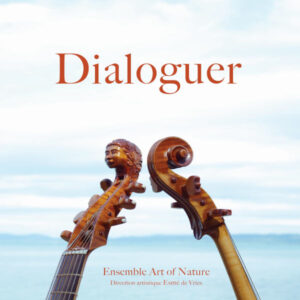Extraits / Excerpts
Fauré: Cello Sonata No. 1, Op. 109 - Sérénade, Op. 98 - Cello Sonata No. 2, Op. 117 - Romance, Op. 69 - Rolf Looser - Urs Voegelin
Gabriel FAURÉ: Cello Sonata No. 1 in D Minor, Op. 109: I. Allegro – II. Andante – III. Final – Allegro commodo – Sérénade, Op. 98 – Cello Sonata No. 2 in G Minor, Op. 117: I. Allegro – II. Andante – III. Allegro vivo – Romance, Op. 69
Rolf Looser, Cello – Urs Voegelin, Klavier
FAURÉ (1845-1924)
„Nicht nur, dass ich Ihre Musik liebe, bewundere, verehre – ich war und bin noch darin verliebt. Lange bevor Sie mich kannten, dankten Sie mir mit einem Lächeln in den Konzerten, wenn meine lärmende Begeisterung Sie in Ihrer gleichgültigen Geringschätzung des Erfolges doch noch zu einer fünften Verbeugung nötigte. Kürzlich berauschte ich mich zum ersten Mal an Ihrem Lied Le Parfum impérissable (Der unverlierbare Duft), und dies ist ein gefährlicher Rausch, denn seither habe ich mich ihm jeden Tag wieder ausgeliefert. Immerhin ist es eine klarsichtige Trunkenheit.“
Diese Zeilen erhielt Gabriel Fauré vom Schriftsteller Marcel Proust.
Die beiden Sonaten für Cello und Klavier, op. 109 und 117, wurden 1917 und 1921 in St. Raphael und Nizza komponiert. Sie verwirklichen – auf ebenso typische wie vielfältige Weise – den Stil der letzten Etappe eines langen Künstlerlebens. In diesem Leben hatten die Dinge Zeit zu reifen, ohne durch ungeduldige Geschäftigkeit oder ein Übermaß an persönlichen Ambitionen gestört zu werden. In all ihren Stadien zeugt Faurés Musik von jener guten, fruchtbaren Distanz, die ein großer Künstler zu seiner Arbeit und zu sich selbst haben kann und muss. Dasselbe darf auch über seine Lebensführung, seine Biographie gesagt werden – ein großes und seltenes Zeichen.
Ganz abgesehen von ihrem einzigartigen musikalischen Reichtum geben die Spätwerke Gabriel Faurés Anlass zu bedeutenden Reflexionen und verdienen eine ganz besondere Aufmerksamkeit – eine Aufmerksamkeit übrigens, die immer noch erstaunlich wenig geweckt und verbreitet ist. Das Paradox dieses Spätstils liegt darin, dass er eine faszinierende Einheit von großer emotionaler Fülle und Höhe einerseits und einer seltsam strengen und transparenten Ökonomie der klanglichen und musikalischen Mittel andererseits erreicht.
Es muss weiter betont werden: Es handelt sich hier nicht nur um Faurés persönlichen Spätstil, sondern auch um den einer ganzen Ära, der Ära, welche die westliche Musik, soweit sie in den tonalen und modalen Ordnungen wurzelt, umfasst. Daher erhält seine „dernière manière“ doppeltes Gewicht und Bedeutung. Fauré war offenbar beauftragt und befugt, die letzten großen noch möglichen Partien innerhalb der tonal-modalen „Spielregeln“ zu spielen.
Er war ein Grenzgänger, der sich gegen Ende seines Lebens ausgiebig in den Randzonen dieses Reiches zu bewegen wagte. Mit einem höheren Spürsinn und einer Sensibilität für äußerst nuancierte Vitalität, fast schlafwandlerischer Sicherheit und Kühnheit, überschritt er diese Grenzen oft unversehens (oder existierten sie nicht für ihn?). So wurde er noch im Alter ein Neuerer, auf dem Weg der Entwicklung, dort, wo andere seiner Zeit dieselben Grenzen als Revolutionäre übersprangen oder gewaltsam durchbrachen.
Sein Spätstil beginnt etwa mit dem Liederzyklus Chanson d’Eve op. 95 (1906) und seiner einzigen Oper Pénélope (1907–12). Diese letzte Schaffensperiode war überschattet von einem für ihn besonders qualvollen Gehörleiden, das jede äußere Klangwahrnehmung grausam verzerrte.
Auf einige Eigenarten der späteren Werke Faurés soll hier kurz hingewiesen werden:
An kontrapunktischen Mitteln setzt er vorwiegend und lapidar die zweistimmige Imitation ein (Kanon oder eng geführte freie Imitation). Es ist, als ob zwei Zugvögel derselben Art einem gemeinsamen Ziel zustrebten. (Die ersten Sätze der Sonaten zeigen dies besonders deutlich.)
Die harmonischen Entwicklungen faszinieren durchweg durch die Kühnheit neuartiger Kombinationen und Fortschreitungen. Die enharmonischen Mehrdeutigkeiten des temperierten Systems dienen hier einer großen Freiheit, welche der harmonischen Bewegung neue, unerwartete und seltsam farbige Wege eröffnet, ohne den weitgespannten musikalischen Zusammenhang und dessen Kommunikation in Frage zu stellen. Im Klavierpart werden die Harmonien oft über weite Strecken hinweg durch ein kostbares Gewebe von Figurationen dargestellt, dessen Dichte eigenartig funkelt. Es ist, als ob die Zeit eine wundersame Haut bekommen hätte.
Im melodischen Bau der Themen beeindruckt vor allem der erstaunlich große Tonumfang, der nicht selten fast drei Oktaven umfasst, und in welchem große Intervalle (gerade auch die Oktave als Melodieschritt!) eine auffallend gewichtige Rolle spielen (z.B. im zweiten Thema des ersten Satzes von op. 109).
Fauré liebt es, seine subtilen und doch kraftvollen Modulationen zu sequenzieren. Es entstehen sozusagen steigende oder sinkende Spiralen, die auf geheimnisvolle Ziele gerichtet sind.
Sehr charakteristisch sind auch die Schlussbildungen der kraftvoll und sicher gefügten Formen: Melodie und Harmonie kreisen lange um den Grundton der Tonalität, bevor sie nach einer weiten Reise im heimatlichen Hafen der Tonika vor Anker gehen.
Vor allem die vier letztgenannten Besonderheiten lassen den Gedanken an Bruckner wach werden. Tatsächlich scheint Fauré der einzige Musiker aus dem romanischen Raum zu sein, der, wenn auch in seiner ganz eigenen Welt, eine Position einnimmt, die der des großen österreichischen Komponisten fast brüderlich gegenübergestellt werden könnte. Beide sind die großen nachromantischen Klassiker.
Zur Reinheit und Größe des Anliegens beider gehört auch eine gewisse Naivität höherer Ordnung. Dass diese in hohem Maße Bruckners Wesen eignete, ist bekannt. Weniger bekannt ist vielleicht diejenige Faurés; sie äußert sich in einer recht gelassenen, heiteren Einfachheit, die zu einer Persönlichkeit passt, die auch genug Humor besitzt, um sich selbst nicht allzu wichtig zu nehmen. – Von seinem Hotelzimmer in Stresa, wo er „mit Entzücken“ an der Chanson d’Eve arbeitet, schreibt er 1906 an seine Frau:
„Mein Text ist schwierig… Es geht darum, Gott Vater und auch Eva, seine Tochter, sprechen zu lassen. Ja, es ist nicht einfach, mit so bedeutenden Personen zu tun zu haben. Und doch schiene es mir noch viel unmöglicher, Herrn und Frau Meyer sich in Musik ausdrücken zu lassen!
Gestern war ein Tag in grauer Seide, sehr heiß, sehr drückend… Und ich, in flanellener Weste, habe sieben Stunden gearbeitet, und ich habe das Problem gelöst, Gott singen zu lassen. Wenn ihr sehen werdet, worin seine Beredtheit besteht, werdet ihr staunen über die viele Zeit, die es mich gekostet hat, um das zu finden. Aber eben, die nackte Einfachheit sich vorzustellen, ist heutzutage wohl das Schwierigste.“
Rolf Looser
- Kategorien
- Komponisten
- Interpreten
- Booklet