Fauré
Fauré komponierte seine 13 Nocturnes zwischen 1883 und 1922. Das sechste Nocturne entstand 1894, in der vollen Reife des damals 50-jährigen Meisters.
Alfred Cortot, der unvergessliche Interpret dieser Musik, beschreibt sie mit tiefem Gefühl als einen „gedankenschweren, nachdenklichen Gesang, das Geheimnis einer verborgenen Melancholie“, gefolgt von einem „Surren rauschender Blätter, begleitet von einer sanften und tröstenden Stimme“.
Es ist wahrhaft eine aristokratische Musik mit subtiler Harmonik und einem unerschütterlichen rhythmischen Fluss. Doch wer sie zu hören weiß, entdeckt darin eine Weisheit und eine freudige Erhabenheit, die, ähnlich wie bei Beethoven, nur durch harte Arbeit und strenge Entsagung erlangt wird.
Toccata und Variationen von Honegger
Die Toccata und Variationen von Honegger, geschrieben im Jahr 1916, ist ein Jugendwerk des damals 24-jährigen Komponisten. Zwar sind darin einige Unbeholfenheiten zu finden, doch zugleich zeigt sich bereits ein sehr persönlicher Stil, der zwischen athletisch, ausdrucksvoll, rau und zart wechselt.
Die Toccata sprüht von gesunder, fast sportlicher Vitalität. Die Variationen, deren Thema an Fauré erinnert (vgl. op. 73), sind ein Trauergesang, in dem die düstere Traurigkeit der langsamen Sätze durch die schicksalhafte Härte der schnellen Variationen unterbrochen wird.
Das Ende ist besonders schön – eine mystische Passage im Geiste der Aria von César Franck, durchdrungen von ernstem, jugendlichem Glauben.
Im Freien von Bartók
Der Zyklus von fünf Stücken Im Freien von Bartók stammt aus dem Jahr 1926. Er ist stark von Debussy beeinflusst, der als einer der ersten die menschzentrierte Welt verließ, in der die Natur lediglich als Hintergrund dient.
Schon bei Debussy spürt man das Gefühl menschlicher Ohnmacht angesichts der gewaltigen, unbarmherzigen Natur. In jedem der fünf Stücke von Bartók wird die schwache menschliche Stimme mit den elementaren Kräften der Rhythmen konfrontiert, mit den unheimlichen Stimmen der Nacht und den chaotischen, harten Dissonanzen, die kein Orpheus zu bändigen vermag.
Im Kern ist dies ein pessimistisch gestimmtes Werk, ohne Selbstmitleid, zugleich beunruhigend und faszinierend.
Pierre Souvairan
Pierre Souvairan wurde in Montreux geboren. Sein Vater stammte aus Südfrankreich, seine Mutter aus dem Aargau. Seine ersten musikalischen Eindrücke erhielt er von Igor Strawinsky, der ein Jahr im Hotel der Familie verweilte und am Sacre du Printemps arbeitete.
Nach klassischen und musikalischen Studien in Lausanne – letztere am Ribaupierre-Institut – studierte er drei Jahre am Leipziger Konservatorium unter Professor Robert Teichmüller, dann in Paris bei Alfred Cortot, und schließlich in der Schweiz bei Rudolf Serkin. Nach 15 Jahren Tätigkeit in Bern, wo er auch am Konservatorium unterrichtete, wurde er 1953 nach Kanada berufen. Er ist Professor an der Musikfakultät der Universität Toronto, kehrt jedoch regelmäßig nach Europa zurück. Im Wallis kann er seinen beiden Leidenschaften treu bleiben: der Musik und den Hochgebirgen.




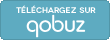










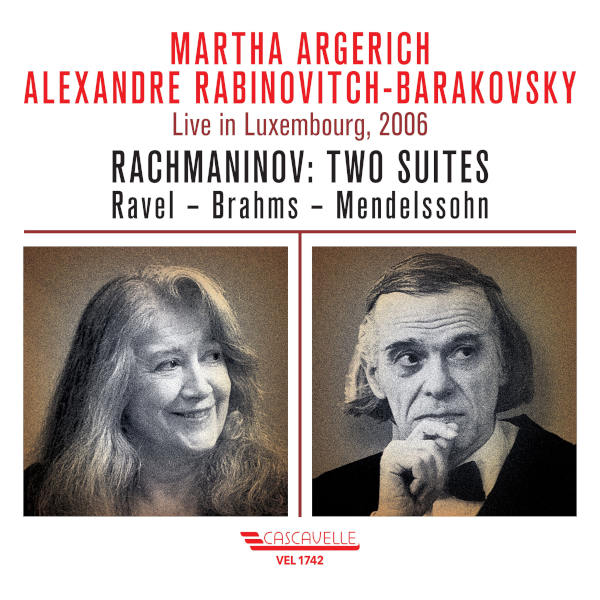
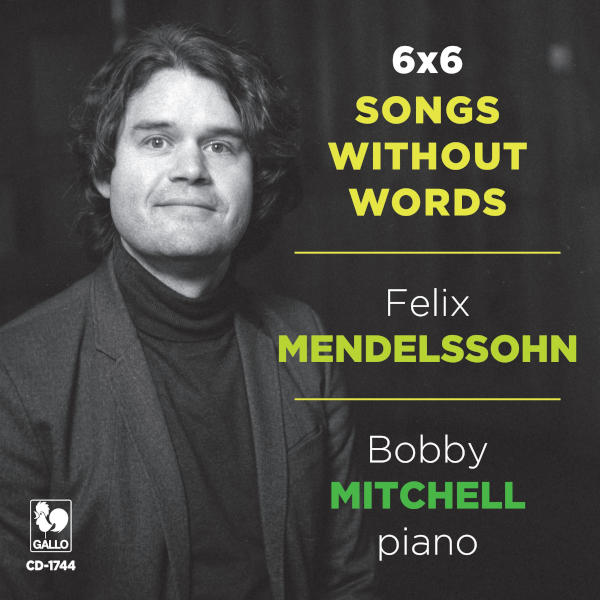
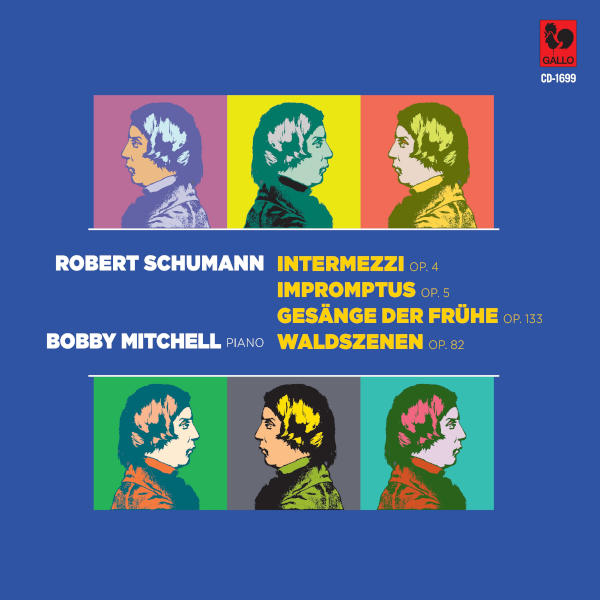
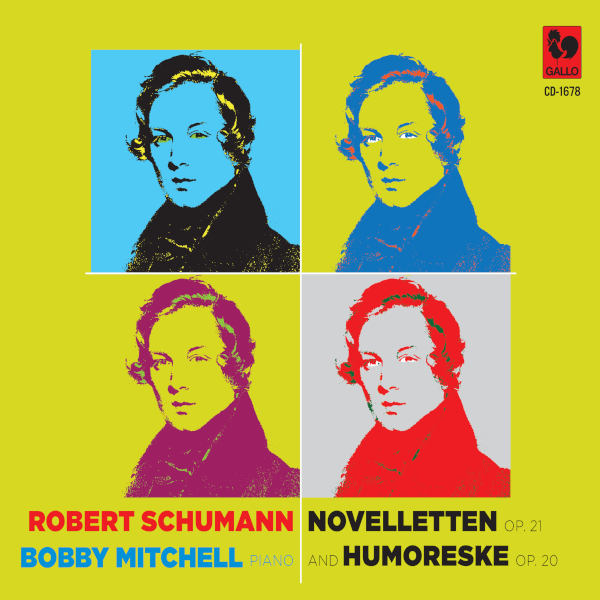
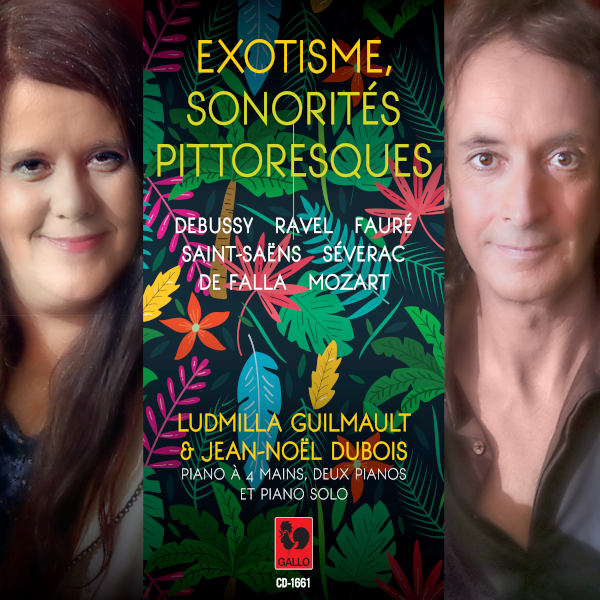

Noch keine Kommentare