Mendelssohn: Variations concertantes – Cello Sonata No. 1 & No. 2 – Lied ohne Worte – Rolf Looser – Brigitte Meyer
30-124
Felix MENDELSSOHN : Variations concertantes, Op. 17, MWV Q19: I. Thema – II. Variation I – III. Variation II – IV. Più vivace Variation – V. Allegro con fuoco Variation – VI. L’istesso tempo Variation I – VII. L’istesso tempo Variation II – VIII. Presto ed agitato Variation – IX. Tempo I. Coda. Più animato – Cello Sonata No. 1, in B-Flat Major, Op, 45, MWV Q27: I. Allegro vivace – II. Andante – III. Allegro assai – Cello Sonata No. 2 in D Major, Op. 58, MWV Q32: I. Allegro assai vivace – II. Allegro scherzando – III. Adagio – IV. Molto Allegro e vivace – Lied ohne Worte, Op. 109, MWV Q34
Rolf Looser, Cello
Brigitte Meyer, Klavier
Man muss mit gewissen Vorurteilen Mendelssohn gegenüber aufräumen. Seine Musik, so hört man, sei der unmittelbare Ausdruck eines glücklichen, wohlhabenden, problemlosen Lebens. Nun war aber diese Existenz nur dem Schein nach glücklich, und wenn Mendelssohn zur Romantik zählt, hindert das nicht, dass er sich zum klassischen Vorbild bekannte.
Ein glückliches Leben eines gewandten, nicht nur musikalisch, sondern auch für die Malerei und Philosophie begabten deutschen Juden – solches inspiriert kaum die Biographen. Aber es ist bestimmt übertrieben zu sagen, das Leben Mendelssohns sei wolkenlos gewesen. Dieser Überempfindliche machte schwere Krisen durch, wovon die letzte, der Tod seiner Schwester im Jahre 1847, ihm das Leben kosten sollte: dabei war er seit zehn Jahren mit der Tochter eines Neuenburger Pfarrers, Cécile Jeanrenaud, verheiratet, hatte vier Kinder, unterhielt eine enge Beziehung zur Sängerin Jenny Lind… welch ein Geheimnis birgt wohl diese tödliche Verzweiflung? Auch körperlich war er ein Geprüfter: langwährende Knielähmung, Cholera… Schließlich war auch seine Karriere nicht nur eine Reihe von Erfolgen: seine einzige Oper, Die Hochzeit der Camacho, war ein Misserfolg; auch fühlte er sich gedemütigt, nicht Nachfolger seines Lehrers Zelter an der Berliner Singakademie werden zu können. Er durchlief depressive Perioden, die zwangsläufig einer intensiven Aktivität folgten.
Falls man in seinem Dasein nur Reisen, Empfänge, Spazierritte, Salonkonzerte, Feste, Hausmusik, Huldigungen und liebenswürdige Konversationen sieht, so vergisst man die Tatkraft, die er als Dirigent, Pianist, Komponist und als Organisator bewies. Er machte aus Leipzig das musikalische Zentrum Europas, er kämpfte für eine angemessene Entlöhnung der Musiker des Gewandhaus-Orchesters, er dirigierte zahlreiche neue Werke; so leitete er unter anderem die ruhmvolle erste Wiederaufführung der Matthäus-Passion von Bach, die Uraufführung der Neunten Symphonie von Schubert, die überall sonst als unspielbar galt – und er schrieb, die unveröffentlichten Werke nicht gezählt, 121 Opus, obwohl er nur zwei Jahre länger lebte als Mozart.
Mendelssohn bekannte sich weiterhin zu einem klassischen Ideal, gegen die Ansichten der «Zukunftsmusiker» wie Liszt und Wagner, von denen er sagte: «Die Musik muss sich nach ihrer Meinung den Bedürfnissen des Fortschrittes gemäß auf die Höhe einer Wissenschaft begeben, muss die Personen und Ereignisse psychologisch darstellen. Für mich hat ein Musiker nicht reine Ideen auszudrücken, sondern er soll in harmonischer Weise Töne zusammenstellen: man fordere nicht das von der Musik, was Bücher liefern.» Man hat ihm eine solch «bürgerliche» Einstellung in den wagnerianischen Kreisen, die während fast eines Jahrhunderts tonangebend waren, übelgenommen. Heute denkt man, dass Mendelssohn die moderne, respektvolle Haltung gegenüber der Musik älterer großer Meister vorwegnahm; ohne sie nachzuahmen, hat Mendelssohn Bach, Händel, Haydn und Mozart wieder zu Ehren gebracht, und das in einer Zeit, in der Hummel als klassisch galt. Man kann diesem Feind jeglichen Systems nur Ehrerbietung bezeugen, der von sich behauptete: «Ich betreibe die Musik gerne ernsthaft. Ich glaube, es steht mir nicht zu, irgendetwas zu komponieren, ohne von meinem Thema völlig durchdrungen zu sein. Es scheint mir, das wäre eine Art Lüge.» Wagner selbst nannte ihn den «größten spezifischen Musiker seit Mozart».
Erste Gesamtaufnahme
Im Werk von Mendelssohn sind die Kompositionen für Violoncello und Klavier besonders vernachlässigt worden; die vorliegende Gesamtaufnahme ist denn auch die erste überhaupt. Sie füllt eine schwerwiegende Lücke, denn es handelt sich hier ohne allen Zweifel um Meisterwerke, ja sogar um einen Höhepunkt im ganzen Cello-Repertoire. Diese Sammlung hebt überdies die Entwicklung Mendelssohns vom ausgehenden Jünglingsalter bis zur Reife besonders hervor. Es ist erfreulich, dass diese erste Schallplatten-Gesamtaufnahme aus der Schweiz kommt, dem von Mendelssohn bevorzugten Land.
Die acht Variations concertantes schrieb Mendelssohn 1828 für seinen jüngeren Bruder Paul, der Cello spielte. Es ist eine zutiefst deutsche Musik, die das ganze Temperament des Komponisten der Ouvertüre zum Sommernachtstraum offenbart. Dem Cello kommt durch seine Transparenz, seine Dichte und seine Poesie ein interessanter Teil zu. Aber wie oft in seinen Sonaten hat sich Mendelssohn den Löwenanteil am Klavier vorbehalten.
Zehn Jahre später veröffentlichte Mendelssohn seine Sonate Nr. 1 in drei Sätzen. Das Allegro vivace ist für seinen großzügigen Lyrismus typisch, der Mittelsatz gleicht eher einem melancholischen Scherzo als einem langsamen Stück: Es ist dies der originellste Zug des mendelssohnschen Stils. Mit dem weitausgreifenden Allegro assai schließt das Werk auf glänzende Weise.
Im Jahre 1843 erschien die Sonate Nr. 2, deren elegische oder leidenschaftliche Romantik das Eingangs-Allegro belebt. Der zweite Satz bringt ein scherzohaftes Funkeln, wie es Mendelssohn eigen ist. Das Adagio drückt eine naive Inbrunst im Sinne von Novalis aus. Sprühend, ungezwungen, voller Zauber und Fantasie ruft das Finale gewisse virtuose Stellen der Konzerte in Erinnerung; die treffsicheren Effekte stehen jedoch immer im Dienste eines tiefen musikalischen Gefühls.
Das Lied ohne Worte op. 109 aus dem Jahre 1845 krönt sowohl das Werk für Violoncello und Klavier als auch die Sammlungen der gleichnamigen 49 Stücke, typisch deutsche Liedübertragungen, die Mendelssohn für Klavier schrieb. Zarteste und innigste Eindrücke verdichtend, formen sie ein kleines musikalisches Gedicht von leuchtender Ausdruckskraft.
Pierre Hugli




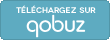




Kommentare anzeigen










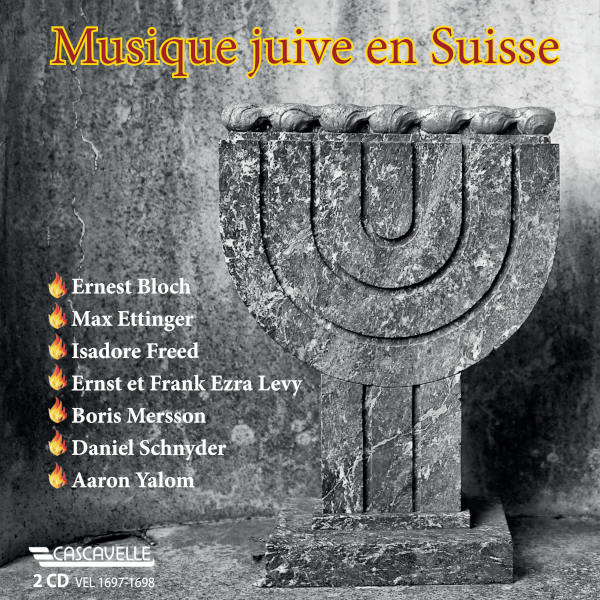

Noch keine Kommentare