Mendelssohn: Die erste Walpurgisnacht, Op. 60 – O Haupt voll Blut und Wunden – Kyrie in C Minor – Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne, Michel Corboz
VEL1057
Felix MENDELSSOHN: Die erste Walpurgisnacht, Op. 60, MWV D 3: Ouvertüre. Das schlechte Wetter – No. 1 Es lacht der Mai – No. 2 Könnt ihr so verwegen handeln? – No. 3 Wer Opfer heut zu bringen scheut – No. 4 Verteilt euch hier – No. 5 Diese dumpfen Pfaffenchristen – No. 6 Kommt mit Zacken und mit Gabeln – No. 7 So weit gebracht, dass wir bei Nacht – No. 8 Hilf, ach hilf mir, Kriegsgeselle! – No. 9 Die Flamme reinigt sich vom Rauch – O Haupt voll Blut und Wunden, MWV A 8: I. Chor „O Haupt voll Blut und Wunden“ – II. Aria „Du dessen Todeswunden“ – III. Choral „Ich will hier bei dir Stehen“ – Kyrie in C Minor, MWV A 3
Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne, Michel Corboz, Leitung.
Es gibt in Goethes Werk zwei Walpurgisnächte. Bekannt ist vor allem diejenige aus dem Faust I, in dem ein typischer Hexensabbat auf visionär-groteske Weise beschworen wird. Dagegen nimmt Goethe in dem 1799 entstandenen Gedicht Die erste Walpurgisnacht ein heidnisches Opferfest während einer Gewitternacht zum Anlass, zwei unvereinbare Seins- und Denkweisen einander gegenüberzustellen.
Das ganze 19. Jahrhundert hindurch haben sich die romantischen Komponisten immer wieder von der Bilderwelt des Faust I und Faust II inspirieren lassen, während Die erste Walpurgisnacht nahezu unbekannt geblieben ist. Nur Carl Friedrich Zelter, Goethes Freund und musikalischer Berater, hatte versucht, das Gedicht zu vertonen. Volle fünfzehn Jahre verwahrte er es unter seinen Papieren, ehe er endgültig von einem Vorhaben Abstand nahm, das seine Einbildungskraft überstieg.
Durch Zelter wurde der damals zwölfjährige Mendelssohn bei dem um sechzig Jahre älteren olympischen Goethe eingeführt, den Zeit und Ruhm geprägt hatten. Nach Beethoven und Schubert zu urteilen, verstand der alte Herr nicht viel von Musik. In seiner Jugend hatte er einige von Mozarts Werken gehört, deren Klarheit und Harmonie er noch im Alter Achtung und Anerkennung zollte; und er fand Gefallen daran, bei dem Berliner Wunderkind aus guter Familie den Nachklang jener Melodien zu verspüren, in denen das Ideal seiner eigenen Jugend wiederauflebte.
Es wäre ungenau, von einer Zusammenarbeit zwischen Goethe und Mendelssohn zu sprechen. Das erste bedeutende Stück, zu dem der Dichter den jungen Musiker anregte, war die Ouvertüre Meeresstille und Glückliche Fahrt, die erst im Jahre 1832, Goethes Todesjahr, zur öffentlichen Aufführung gelangte. Es ist zu bezweifeln, dass Goethe eine Musik zu würdigen gewusst hätte, die so eindeutig unter Beethovens Einfluss stand. Ebenso wenig hätte ihm wahrscheinlich die Partitur der ersten Walpurgisnacht behagt. Das Werk, in dem Orchester und Stimmen eng ineinander verwoben sind, wird dem zentralen Gedanken des Künstler-Philosophen nicht ganz gerecht. Von seinem „Faible für Hexen“ verführt, hat Mendelssohn wenig Interesse an der tieferen Bedeutung des Gedichts bekundet: dem immerwährenden Konflikt zwischen den instinktiven Naturkräften einerseits und der geistigen Klarheit einer durch die Aufklärung geprägten Gedankenwelt andererseits. Mit der vornehmlich romantischen Behandlung des Gegenstandes bleibt er auf der Ebene eines deskriptiven Gedichts und reißt uns in den Taumel einer entfesselten Gewitternacht.
Die 1831 vollendete erste Niederschrift der Partitur erfuhr erhebliche Veränderungen, bevor sie 1842 zur Uraufführung gelangte. Goethe hat nicht mehr erfahren, welche Bestimmung seinen Versen zuteil wurde, deren Vertonung ihnen ein faszinierendes jugendliches Feuer verleiht. Mendelssohn erweist sich hier als echter Romantiker. Er verwendet eine Palette prächtiger Klangfarben, lässt die Hörner aus dem geschmeidigen Gewebe der Streicher hervortreten und gibt den Holzbläsern eine höchst persönliche Note. Die Chöre sind von einer Schlichtheit, die ihnen zuweilen den ernsten Charakter eines Volksliedes verleiht, während den Solisten regelrechte große Arien zugewiesen werden. Der ganze Reichtum der romantischen Oper findet sich in dieser musikalischen Illustration eines Gedichts vereint, das an den Feenzauber shakespearscher Szenen erinnert. Der Chor der Druiden (Nr. 6 der Partitur) ist von einem Einfallsreichtum, den erst der späte Verdi im letzten Akt seines Falstaff wieder erreicht. Der Komponist, an dem Goethe das seine eigene Jugend heraufbeschwörende, irgendwie nicht ganz zeitgemäße schätzte, zeigt sich hier erstaunlicherweise als einer der Propheten der Musik des 19. Jahrhunderts. Mit Entschiedenheit sichert er den Übergang von Beethoven zu den großen Rhapsodien von Brahms.
Jean-Francois Labie
Übers. Ingrid Trautmann
Nicht vorrätig




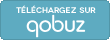



Kommentare anzeigen

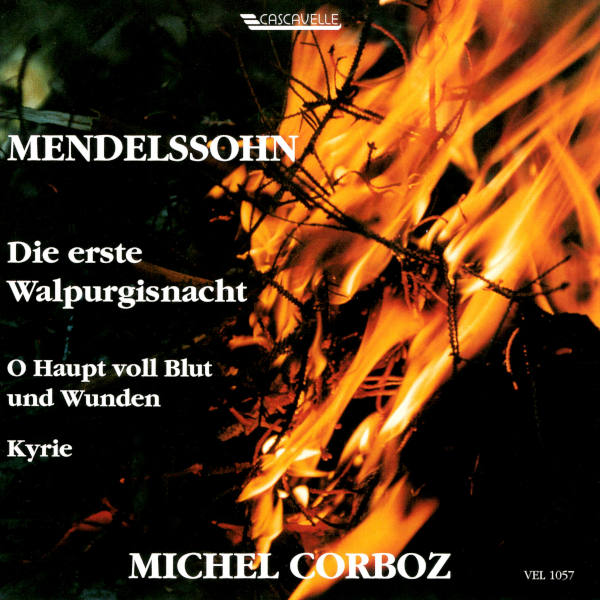





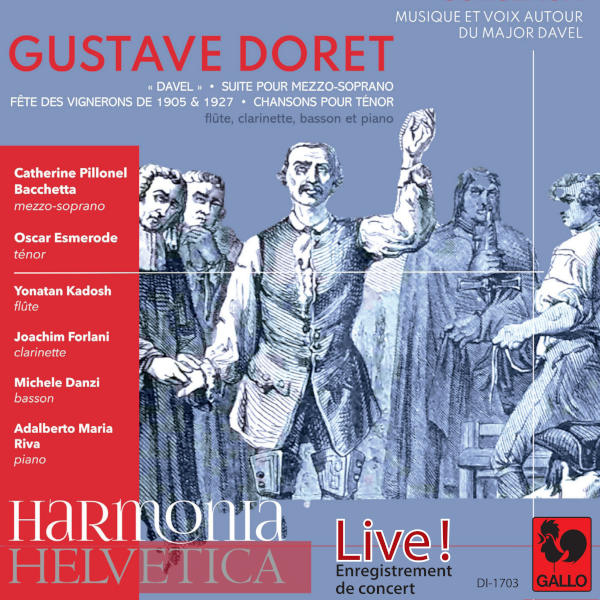
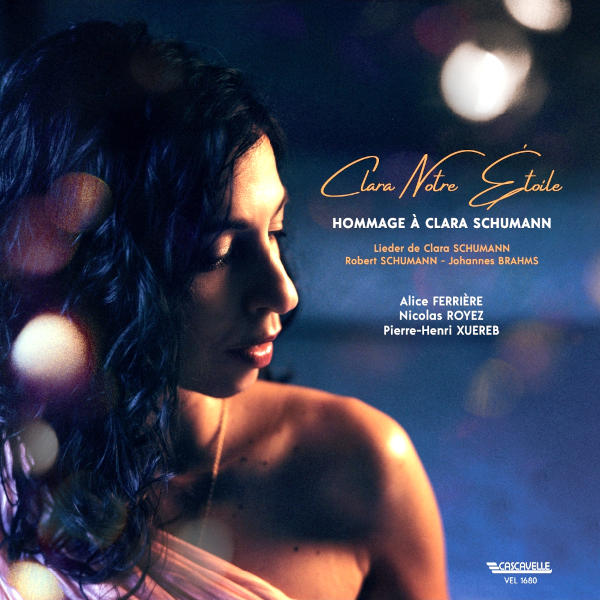



Noch keine Kommentare